eEuro nicht analog denken
Die Digitalisierung brachte viele individuelle Bequemlichkeiten, aber viele negative Effekte auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Müssen wir also wirklich unser Geld digitalisieren? Müssen Währungen wirklich Daten sammeln und programmierbar sein?
Wir glauben leider ja, wenn die Zivilgesellschaft sich dem Thema nicht annimmt, dann übernehmen dies andere, die damit ausschließlich ihre Profit- und Machtinteressen verfolgen. Wenn in Gänze auf digitales Geld verzichtet wird, dann überlässt man das Feld privaten Konzernen, riskiert also alle Nachteile ohne Chance auf Vorteile. So geschehen bereits im Juli 2025 in den USA, als Präsident Trump mit dem „Genius Act“ digitales Geld faktisch den Tech-Monopolisten überließ. Leider hat sich auch der eEuro-Berichterstatter im Europäischen Parlament, F. Navarette (EVP), für privatwirtschaftliche Lösungen ausgesprochen. Tech-Konzerne, insbesondere die amerikanischen, verstehen digitale Geschäftsmodelle und werden versuchen, ihr altbewährtes Erfolgsrezept auch beim digitalen Geld abzuspulen – und mit Lock-in-Fallen und Netzwerkeffekten Monopole aufzubauen. Nicht vergessen ist Christian Lindners Aussage als Finanzminister, dass Gelder nicht ausgezahlt werden können, weil der Staat zwei Jahre bräuchte, um zwei Nummern miteinander zu verknüpfen. Es besteht also Bedarf für datengetriebene Bezahlungen. Wenn der eEuro diese Lücke nicht schließt, werden private Anbieter dies tun. Ein digitales Produkt, wird definitionsgemäß immer Daten sammeln können und programmierbar sein, und somit auch digitales Geld. Jetzt könnte man den eEuro so einstellen, dass beides nicht funktioniert, würde damit aber das Feld den Tech-Konzernen überlassen.
Dazu ein vereinfachtes Beispiel:
Digitales Geld analog gedacht und die Langzeitfolgen
Stellen wir uns vor, dass der eEuro nur eine Art Paypal-, Überweisungs- oder Kreditkartenersatz ist, mit dem wir morgen bezahlen können. Beim Bezahlen werden keine weiteren Daten übergeben. Es können keine datengetriebenen Automatismen und Vereinfachungen genutzt werden, dann könnte ein Tech-Unternehmen folgende Strategie verfolgen:
Dann startet ein Tech-Unternehmen damit, eine digitale Brieftasche (Wallet) anzubieten, in der die Menschen ihren eEuro aufbewahren können. Weil Elon Musk sein X, ehemals Twitter, auch zum Finanzdienstleister anbieten möchte, nehmen wir an, dass X diese Wallets anbietet, natürlich kostenlos. Irgendwann definiert X dann Schnittstellen (egl. APIs), über die Daten bei einer Bezahlung von einer X-Wallet zu einer anderen X-Wallet übergeben werden. Für den Anfang werden nur die Rechnungen der gekauften Waren und Dienstleistungen übergeben. Das ist für mich natürlich praktisch, weil ich keine Belege, die ich bisher mal per Post, mal per Mail bekam, sammeln muss, denn die liegen nun zentral in meiner X-Wallet. Wenn ich etwas suche, dann schaue ich nur in mein X-Onlinebanking und finde es. Also versuche ich immer regelmäßiger über X zu bezahlen und natürlich kaufe ich bevorzugt dort, wo der Verkäufer auch ein X-Konto hat, damit ich automatisch meine Quittungen erhalte. X erweitert sein Angebot dann schnell um Vereinfachungen, die sie mir kostenlos anbieten. Sie kennen ja viele meiner Ein- und Auszahlungen und machen anhand der Daten für mich die Steuererklärung, meinen Elterngeldantrag, kündigt meine Abos oder erstellen meine Reisekostenabrechnung, wenn ich auf einer Dienstreise war – als fauler Mensch zahle ich spätestens jetzt meine eEuro Rechnungen nur noch aus meiner X-Wallet heraus.
Für Handwerker bietet X einen besonderen Service an: X erstellt automatisch anhand der Einkaufsdaten und der Gehaltszahlungen der Angestellten, die Rechnungen für die Kunden. Auch übernimmt X die Umsatzsteuervoranmeldung und andere Bürokratie, wie z.B. das Anmelden neuer Mitarbeiter. Große Konzerne können zusätzlich ihre Abläufe durch smart Contracts automatisieren und so viel Personal einsparen. Spätestens jetzt akzeptieren viele der Firmen ausschließlich Zahlungen aus einer X-Wallet heraus, weil dies ihr Leben vereinfacht und X ihnen Komplexität abnimmt.
Elon Musk kann als reichster Mensch der Welt weitere aussichtsreiche eEuro-Wallet Betreiber aufkaufen, lässt sie zwar unter eigenem Namen weiterlaufen, gliedert sie aber in sein X-Wallet System ein. Der Netzwerkeffekt greift irgendwann und Menschen, die ihren Handwerker bezahlen oder Essen kaufen wollen, benötigen dafür eine Wallet aus dem Musk-Universum. So schafft er sein Monopol. Dann fängt er an, Regeln zu definieren: Menschen, die im Netz Tesla- oder AFD-kritische Inhalte posten, müssen höhere Überweisungsgebühren bezahlen. Oder jemand, der eine Petition für eine Digital- oder Reichensteuer unterschreibt, wird vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Im Grunde setzt er das Muster fort, dass er bereits bei der Übernahme von X gezeigt hat. Nur dass jetzt nicht mehr nur die Twitterkonten von unliebsamen Menschen gesperrt werden, sondern diese vom Onlineshopping ausgeschlossen werden und keine Handwerker mehr finden. Musks Macht würde ins Unermessliche steigen.
Digitale Blockaden werden heute bereits eingesetzt. So wurden als Konsequenz der Verteilung Netanyahus durch den Internationalen Strafgerichtshof mehrere Richter und Ankläger von allen US Diensten abgeschnitten (Alle Daten und E-Mails auf Microsoft-Servern, soziale Plattformen oder PayPal, Mastercard und Visa, mit deren Infrastruktur auch fast alle europäische Banken arbeiten).
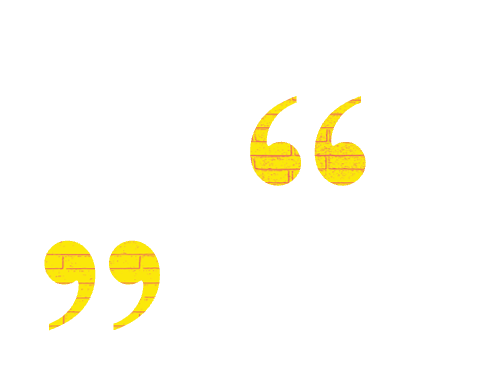
In der Praxis kann die US-Exekutive jeden europäischen Bürger vom Bankensystem und dem digitalen Raum seines eigenen Landes
ausschließen. Das deckt Europas Souveränitätsdefizit
auf.
Nicolas Guillou, französischer Richter ICC
Diese Dystopie ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Aber selbst in abgeschwächter Form wäre es höchst problematisch, wenn eine kleine Gruppe privater Zahlungsdienstleister eine marktbeherrschende Stellung erreichen würde, die primär durch Profitinteressen getrieben werden. Sie erhalten in jedem Fall sehr viel zusätzliche Macht und gefühlt ist die Macht von Menschen mit Profitinteressen heute schon zu groß für funktionierende Demokratien.
Es ist heute schwer vorstellbar, dass solche Szenarien eintreten. Aber vor 30 Jahren war das Internet auch ein dezentrales, frei zugängliches, öffentlich Netzwerk ohne Eintrittsbarrieren. Es war unvorstellbar, dass irgendwann einmal ganz wenige große Monopolisten bestimmen, welchen Content die Milliarden von täglichen Nutzern konsumieren: Professor Martin Andree hat dies in seinem Atlas der digitalen Welt mathematisch aufbereitet und kommt zum Ergebnis, dass 7 Unternehmen für mehr als die Hälfte des täglichen Internettrafics verantwortlich sind. Abseits dieser Monopolisten erhalten selbst Großkonzerne oder Nachrichtenportale keinen nennenswerten Internettrafic, also Aufmerksamkeit im digitalen Raum. Wenige Monopolisten haben sich als Gatekeeper (Türsteher) etabliert, die bestimmen, welche digitalen Inhalte gesehen werden und welche nicht. Die Position als Gatekeeper nutzen sie genauso wie die Türsteher vor Clubs; mitfeiern darf nur wer ihnen passt und bezahlt. Die Gatekeeper nutzen diese immense Macht für ihre politische Agenda und für die persönliche Profitmaximierung. Das Risiko einer solchen Entwicklung besteht auch bei digitalem Geld.
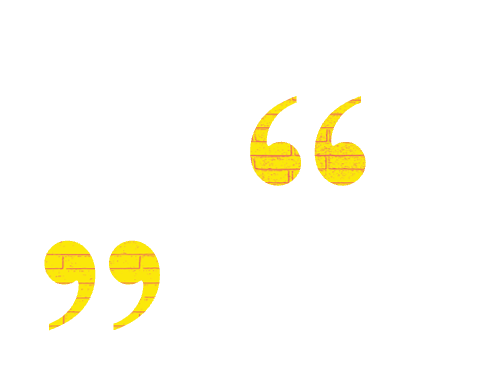
In unserer westlichen Welt ist gesellschaftliche Teilhabe viel zu stark daran geknüpft, dass man die Dienste der mächtigsten Tech-Konzerne nutzen muss.
Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal-Stiftung
Netzwerkeffekt nutzen, um Datenmonopole aufzulösen
Auch wenn die Dystopie von Tech-Konzernen mit Geld-Monopol noch weit weg klingt, ist sie sehr wahrscheinlich präsent in den Strategiemeetings der Tech-Konzerne. Zum einen, weil für den Ersten, der es schafft den Standard zu setzen, immens viel Macht und Profit winkt. Zum anderen aber auch, weil für die Tech-Konzerne jederzeit ein großes Risiko besteht, die Gatekeeper Position zu verlieren, und damit die einzige Berechtigung für ihre Milliardenbewertung. Und genau dieses Risiko der Tech-Konzerne ist die Chance der Zivilgesellschaft:
Geld benötigt so ziemlich jeder Mensch fast täglich. Also wird in 5-10 Jahren jeder Mensch eine digitale Brieftasche für seinen digitalen eEuro besitzen, mit der er auch sehr regelmäßig interagieren wird. Damit erreicht man also fast 100% der Menschen, perfekte Vorbausetzungen für den Netzwerkeffekt im Sinne der Zivilgesellschaft. Marc Zuckerberg, dessen Konzern Meta der zweitgrößte Gatekeeper ist, drückte seine Befürchtungen in einer internen Mail wie folgt aus: „Der Netzwerkeffekt könne sich gegen Facebook wenden, wenn ein Konkurrent, der neue Funktionen biete, rasch wachse.“ Wie schnell Firmen dann in der Bedeutungslosigkeit versinken, beweisen MySpace, Knuddels und Studivz, aber auch Google, das trotz Milliardeninvestitionen es nicht schaffte, sein soziales Netzwerk Google+ zu revitalisieren.
Stellen wir uns also einmal vor, dass:
- diese digitale Brieftasche nun zu einem umfangreichen Datenspeicherort ausgebaut wird. In unserem Konzept der „persönlichen digitalen Brieftasche“ liegen dort dezentral alle Daten, die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Konsumverhalten produzieren und niemals auf zentralen Servern, weder staatlich noch privat. Mit der digitalen persönlichen Brieftasche entsteht ein sicherer Ort für persönliche Daten. Brauchen Unternehmen dann Daten für Werbezwecke, dann können sie diese direkt bei den Bürgern anfragen und kaufen. So fließen die immensen Werbeeinnahmen, die bisher die Tech-Monopolisten erhielten, direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern.
- Mit den persönlichen digitalen Brieftaschen wird eine Plattform geschaffen, auf der viele digitale Anwendungen aufsetzt werden können. Es wird auch der Zugangspunkt für alle Menschen zum digitalen Raum. Das erspart den Nutzer*innen eine Vielzahl von Apps, Registrierungen und dergleichen und macht gleichzeitig die Plattformökonomie der Tec-Monopolisten unrentabel. Unter anderem könnte man jeder sich mit seiner persönlichen digitalen Brieftasche überall anmelden und dort auch die Anmeldeschlüssel speichern, quasi ein single Sign-On, wie es heute bereits Google, Apple und Meta anbieten. Das schafft eine Plattform für alle Firmen, um schnell und einfach den digitalen Kontakt mit ihren Kunden herzustellen. So wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass die oben beschriebenen Bürokratie-Automatisierung-Programme von unzähligen Firmen angeboten werden. Nutzer können dann das passende Programm in ihre digitalen Brieftaschen laden. Dort verrichten die Programme ihre Arbeit, erstellen die Steuererklärung, den Elterngeldantrag, die UST-Voranmeldung, etc. und löschen sich danach wieder, ohne dass Daten aus der persönlichen Brieftasche nach draußen transportiert werden.
- Die Grenzkosten für digitale Produkte sind nahezu 0. Nach Abschluss der Entwicklung, kostet es den Hersteller so gut wie nichts mehr, das Produkt an einen zusätzlichen Kunden zu verkaufen. Auf einem funktionierenden Markt müssten also die Preise für digitale Produkte nach einer gewissen Amortisationszeit sehr klein werden, wenn nicht sogar kostenlos. Das betrifft alle Dienste wie Datenspeicherung, Streaming, Kommunikation, Software oder digitale Plattformen. Trotzdem schaffen es die Tech-Monopolisten immense Gewinne zu erwirtschaften, weil sie die Daten auf ihren eigenen Servern sichern und als Gatekeeper den Zugang zu den Daten kontrollieren. Das ändert sich schlagartig, wenn die Daten zukünftig bei den jeweiligen Dateneigentümern liegen, und die Dateneigentümern selbst entscheiden können, welchen Unternehmen sie Zugriff auf ihre Daten gewähren. Digitale Produkte werden günstiger und die heutigen Daten-Monopolisten müssten ihre Geschäftsmodelle verändern, um wieder Produkte zu vermarkten, die einen echten Mehrwert für die Konsumenten haben. Gleichzeitig verschwindet der Anreiz für Plattformen, Nutzer mit immer radikaleren Inhalten an sich zu binden. (Falschnachrichten, Hass und Hetze lassen sich nicht mehr kommerzialisieren)
Das alleine wäre schon ein Problem für die Geschäftsmodelle der heutigen Tech-Monopolisten. Zusätzlich könnte mit einer digitalen Währung neue Regeln für Wirtschaftsunternehmen eingeführt werden, die Profit mit dem bestmöglichen Erreichen von Zielen verknüpft (siehe Whitepaper oder Buch) . Für Digitalkonzerne könnten das sein:
- Offene Standards und APIs
- Weniger Falschnachrichten und ausgewogene Berichterstattung
- kein Hass und Hetze verbreiten
- Keine Ausnutzung von Monopolstellungen
- Minimierung von süchtig machenden Algorithmen und Mechanismen
- keine Aufmerksamkeitsökonomie
So wird ein ganz neuer digitaler Raum vorstellbar.
Bei der eEuro Gestaltung muss also besonders darauf geachtet werden, dass das Risiko eines privaten Zahlungsmonopols (via Locked-In-Mechanismen und Netzwerkeffekt) minimiert wird. Und wenn man den eEuro schon einführt, dann könnte dabei viele Fehler korrigiert werden, die durch die Kommerzialisierung des digitalen Raumes entstanden sind.
Diese Chance für die Zivilgesellschaft wäre ein Schreckensszenario für die heutigen US-Tech-Monopolisten, weswegen sie wahrscheinlich auf Trump einwirkten, der ihnen mit dem Genuis-Act im Juli 2025 die Lizenz zum „Drucken“ von eigenem digitalen Geld gewährte. Die zugrundeliegende Regulierung umfasste dabei übriges nur die Bezahlebene von digitalem Geld und nicht die Datenebene, die überlässt man vollständig den privaten Tech-Konzernen.
Digitales Geld wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist, wer die Regeln dafür festlegt. Wenn wir zeitnah einen gesellschaftlichen Diskurs schaffen, können wir den Prozess für das Gemeinwohl gestalten, ansonsten überlassen wir das Feld den Tech-Konzernen – und damit genau jenen Akteuren, die heute schon als Gatekeeper den digitalen Raum dominieren und damit unzählige Probleme verursachen. Wenn wir jetzt handeln, können wir den eEuro demokratisch gestalten, unsere Daten schützen und die Macht über das Geldsystem in die Hände der Gesellschaft legen.

