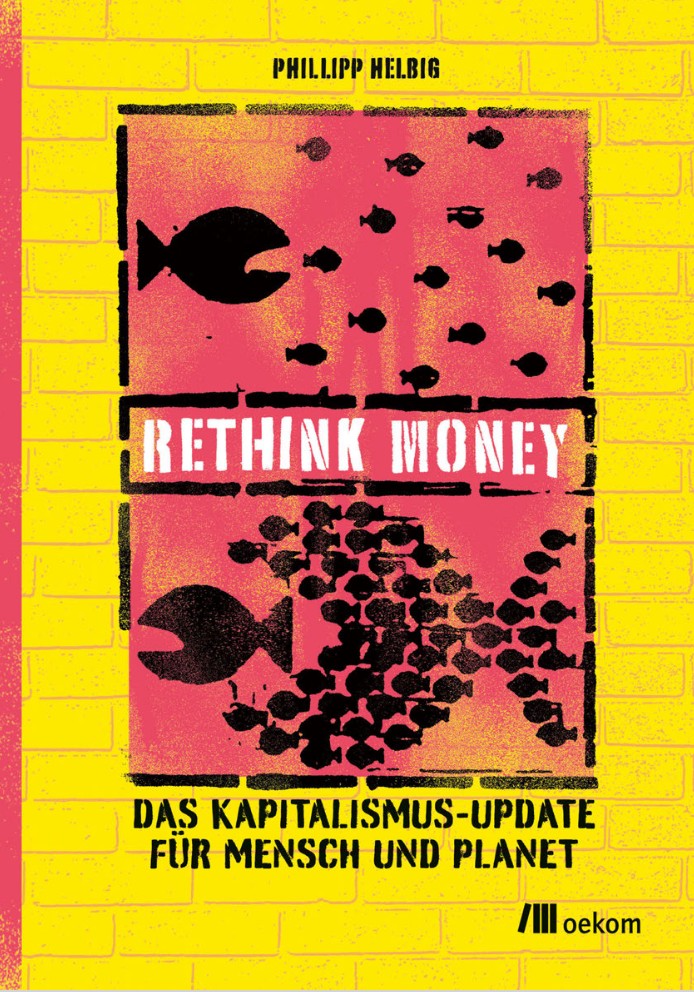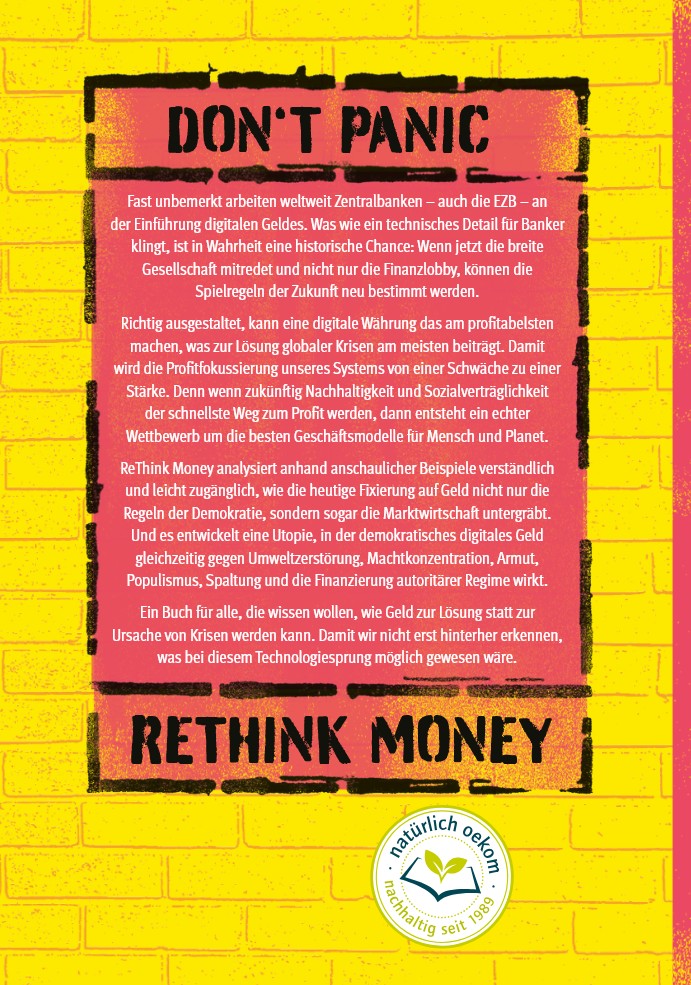Ein neuer Code braucht ein solides Fundament
Um die Chancen von digitalem Geld zu heben, braucht es ein solides, gerechtes Fundament. Dafür empfehlen wir die folgenden Maßnahmen:
1. Geld demokratisieren
Digitales Geld kann – so wie jedes digitale Produkt – programmiert werden, auch wenn das heute noch nicht vorgesehen ist. Diskussionen über den Einsatz von Palantir und Pegasus, Bezahlkarten für Schutzsuchende oder Sanktionen für Bürgergeldempfänger zeigen, dass bereits demokratische Politiker Geld und Daten als Repressionsinstrument nutzen möchten. Das dürften sich noch mal verstärken bei einer Regierungsbeteiligung von Faschisten und Populisten. Und digitales Geld wäre das ideale Repressions- und Kontrollinstrument. Denn technisch ist es einfach möglich, Regeln ins digitale Geld zu programmieren, die unliebsame Menschen identifizieren und sanktionieren.
Um dem entgegenzuwirken, sollte jede Änderung des Codes – also jede Regel im Geld – von einer Mehrheit der Bürger*innen (mindestens 50,1 %) demokratisch akzeptiert werden. Wie in einer liberalen Demokratie sollten auch digitalem Geld Institutionen zur Seite gestellt werden, die die Rechte von Individuen und Minderheiten schützen: ein digitales Grundgesetz, ein Ethikrat und eine neue staatliche Gewalt, die im Rahmen der Gewaltenteilung unabhängig von den anderen staatlichen Gewalten ist und sich um offene und Transparente Gestaltung des Codes der digitalen Währung kümmert.
Denn der Code des Geldes darf nicht hinter verschlossenen Türen entstehen, sondern soll als Open Source transparent einsehbar sein. Wenn jede Änderung des Programmcodes im eEuro von der Mehrheit der Menschen legitimiert wird, wird Geld ein Werkzeug der Gesellschaft – und kein Machtinstrument weniger.
2. Neue Anonymität & ein privates Zuhause für Daten
Jede Zahlung mit digitalem Geld erzeugt Daten. Ziel muss sein, dass diese Daten im Besitz der Menschen bleiben, die sie erzeugen – und niemals auf zentralen Servern liegen.
Dafür braucht jeder Mensch, auch ohne IT-Affinität, einen lokalen Speicherort für die eigenen Daten. Wir fordern, dass diese Daten dezentral in persönlichen digitalen Brieftaschen der Dateneigentümer gespeichert werden und dass keine Daten gespeichert werden, die eine Identifikation von Einzelpersonen oder Gruppen ermöglichen. Neben einem besseren Datenschutz entsteht so auch eine neue Plattform für digitaler Selbstbestimmung und Teilhabe.
3. Bürokratie automatisieren, Alltag vereinfachen
Der Kapitalismus hat enorme Komplexität aufgebaut, die Menschen und Unternehmen belastet. Das Einzige, was ihn zusammenhält und einen Großteil der Abläufe steuert, ist Geld. Die Daten hinter den Zahlungen können genutzt werden, um bestimmte Prozesse zu automatisieren – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen.
4. Transparenz schaffen
Die Daten sollen vollständig geheim bleiben und nur in den digitalen Brieftaschen der Dateneigentümern liegen. Trotzdem könnte man in digitales Geld Mechanismen einbauen, die es Wirtschaftsunternehmen ermöglichen, bestimmte Sachverhalte anhand ihrer Zahlungen zu verifizieren. Da nahezu alles in unserer Wirtschaft auf Geld basiert, erkennt der digitale Euro, welche Geschäftsmodelle Kosten externalisieren – also an Umwelt und Gesellschaft auslagern – oder wer Profite maximiert, indem politische und wirtschaftliche Macht ausgenutzt wird. Genauso wird auch transparent, wer Schlagzeilen, Medienkampagnen oder Studien finanziert, die heute noch das Label „unabhängige Studie“ tragen. Wessen Geschäftsmodell basiert vor allem auf Aufmerksamkeitsökonomie? Was sind Schein- oder Briefkastenfirmen? Wer kauft vor allem KI-Rechenleistung für digitale Produkte? Oder auch: Welcher Politiker erhält überraschend viele Nebeneinkünfte – und von welchen Organisationen?
Insgesamt werden Wechselwirkungen und Abhängigkeiten durch Transparenz in den Zahlungsströmen deutlich besser sichtbar. Lies im Konzept ab S. 138 bis 145, wie dies zur digitalen Anonymität passt
5. Neue Formen der Wirtschaftssteuerung
Kombiniert man diese ersten vier Bausteine, könnte eine völlig neue Form der Wirtschaftssteuerung entstehen – ja, sogar ein anderer Kapitalismus wird vorstellbar.
Die Transparenz macht es einfach zu erkennen, was „gutes Wachstum“ ist (z. B. Ausbau erneuerbarer Energien, Bildung, Ernährung, medizinische Versorgung, sozialverträglicher Wohnungsbau etc.). Neue Regeln im eEuro könnten dieses „gute Wachstum“ besonders profitabel machen und so gezielt fördern, während destruktives Wachstum unrentabel wird und dadurch so schnell wie möglich beendet wird. Diese neuen Regeln würden Nachhaltigkeit und Gemeinwohl im Geld konsequent mit Profit verknüpfen. Denn: Geld steuert Verhalten – besonders das der Wirtschaft.
Wenn wir wollen, dass ökologische und gesellschaftliche Verantwortung, Pflege, Bildung, faire Vermögensverteilung und Verantwortung im digitalen Raum Priorität haben,
dann können wir das in den Code des digitalen Geldes schreiben. Dann führt die Profitgier aller Wirtschaftsakteure dazu, dass sie möglichst schnell anfangen, die Probleme der Menschen zu lösen.
Wir müssen heute noch nicht jedes Detail des neuen Codes kennen,
aber wir müssen sicherstellen, dass die Grundlagen geschaffen werden, damit sich dieses Update künftig einspielen lässt –oder beliebige andere Korrekturen, die eine demokratische Mehrheit finden.
Achtung: Kapital nicht den Kapitalisten überlassen
Beim ersten eEuro-Beta-Test wurden etwa 70 Tester*innen eingebunden – mit einer Ausnahme stammen alle aus der Wirtschaft, mit Nähe zu Banken, Superreichen oder Tech-Monopolisten. Also Alle die vom aktuellen System überproportional profizieren und somit wenig Interesse an Veränderungen haben, die ihre Macht oder Profitinteressen gefährden.
Gravierender ist jedoch, dass die EZB beim eEuro vor allem auf die Bezahlebene achtet und die Datenebene ignoriert. Das wird besonders dann zum Problem, wenn Akte wie Trumps „Genius Act“ digitales Geld für Tech-Monopolisten öffnen. Diese Konzerne verstehen datengetriebene Geschäftsmodelle und nutzen Automatisierung, Lock-in-Mechanismen und Netzwerkeffekte, um De-facto-Standards zu etablieren und Monopole zu schaffen.
Schaffen die Tech-Firmen dies beim Geld, werden sie endgültig zu mächtig für funktionierende Demokratien – denn schon heute scheinen Demokratien die Macht von Konzernen kaum noch aushalten zu können.
Wichtig ist: Wir müssen nicht jedes Detail heute final definieren. Im Gegenteil – wenn das unser Anspruch wäre, wären wir zu langsam, während Tech-Firmen mit ihrem agilen Vorgehen längst Fakten und Standards schaffen. Aber wir müssen heute eine Vision entwickeln, wie wir digitales Geld gestalten wollen. Andernfalls tun es jene, die heute schon nah am Thema Geld sind – und sie werden damit ihre Machtstrukturen zementieren.