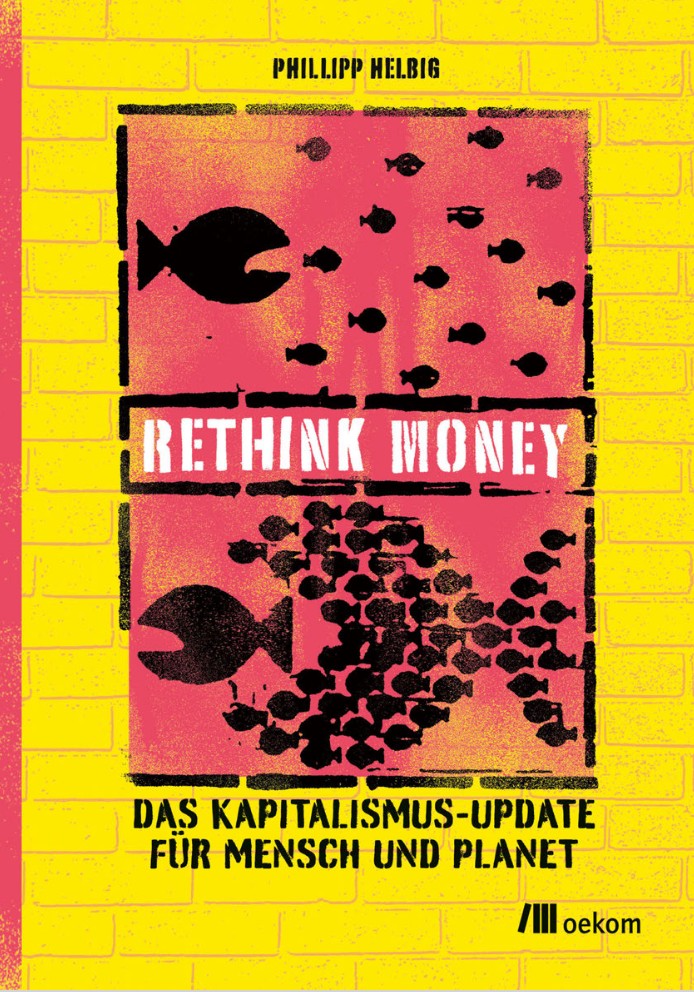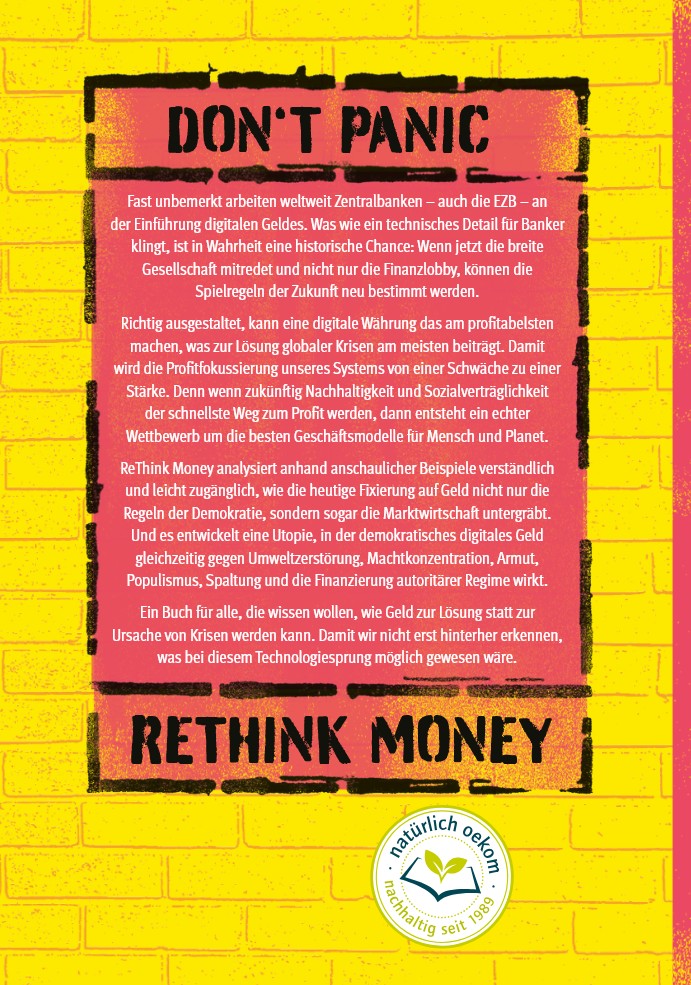Mit einem demokratischen eEuro aus der Polykrise | Unsere Chance auf digitale Basisdemokratie
Intro
Geld ist das zentrale Instrument unserer durchkapitalisierten Gesellschaft. Es steuert nahezu alle menschlichen Beziehungen. Es bestimmt, wofür Menschen morgens aufstehen, welche Tätigkeiten sich lohnen, welche Ideen wachsen oder verschwinden, welche Nachrichten sich verbreiten, was den öffentlichen Diskurs bestimmt und welche Ressourcen ausgebeutet werden. Doch dieses Steuerungsinstrument hat gravierende Mängel, denn es ermöglicht, Gewinne zu privatisieren, während Kosten auf Umwelt und Gesellschaft abgewälzt werden. Es belohnt kurzfristige Profite statt langfristiger Verantwortung, Wettbewerb statt Kooperation, Ausbeutung statt Gemeinschaft. Zudem untergräbt es demokratische und politische Prozesse. So produziert Geld Abhängigkeiten, Ungleichheit und Krisen – bis hin zur Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage.
Natürlich sind die dahinterliegenden Gründe vielfältig, unter anderem: neoliberaler Kapitalismus, Wachstumszwang, globaler Verdrängungswettbewerb, Egoismus, Populismus, Polarisierung, Entfremdung, Chancen- und Bildungsungleichheit u. v. m., aber Geld ist das verbindende Instrument, das aus all dem eine Polykrise macht. Und gerade öffnet sich ein historisches Fenster: Wir digitalisieren unser Geld und können dabei dieses zentrale Steuerungsinstrument korrigieren – und so unzähligen Krisen etwas entgegensetzen.
Geld wird digital – und damit programmierbar
Weltweit entwickeln Zentralbanken derzeit sogenanntes digitales Zentralbankgeld (CBDC, Central Bank Digital Currency) – in Europa arbeitet die EZB am digitalen Euro (eEuro).
Hier ein Video und eine Erklärung des Finanzministeriums

Der eEuro wird nicht einfach nur elektronisches Bargeld, sondern eine neue Form von Geld, das neben reinen Zahlungen auch Daten überträgt und Transparenz schaffen kann.
Wie jede Veränderung bietet auch die Entwicklung des eEuros große Chancen, aber auch Risiken:
Chancen mit Utopiecharakter
- Priorität sollte es haben, Geld zu demokratisieren. Wenn digitales Geld mit Regeln versehen wird, dann müssen diese Regeln von den Menschen demokratisch gewählt werden. Das würde zum einen neoliberale Machtstrukturen aufbrechen und die durch Geld verursachten Demokratielücken, wie z. B. Lobbyismus oder Korruption, schließen. Zum Anderen wäre demokratisches digitales Geld deutlich faschismussicherer (siehe Teil 2).
- Der eEuro schafft eine Transparenz in den Zahlungsströmen. Ist er demokratisch gestaltet, können die Menschen wählen, ob diese Transparenz ihr persönliches Zahlungsverhalten offenlegt oder doch lieber politisch-wirtschaftliche Verflechtungen sichtbar macht oder die gekaufte Beeinflussung des öffentlichen Diskurses. Dann macht es diese Transparenz leicht zu erkennen, von wem Schlagzeilen oder Studien finanziert werden, wo finanzielle Interessenskonflikte bestehen oder welche Inhalte durch KI generiert wurden. Die Transparenz darf jedoch nur dort hergestellt werden, wo problematische Entwicklungen bestehen, und keinesfalls im persönlichen Zahlungsverkehr. Deshalb wird der eEuro nur als Ergänzung zu Bargeld ausgegeben, sodass Privatpersonen für anonyme Zahlungen weiterhin Bargeld nutzen können.
- Eine Transparenz in den Zahlungen zeigt auch auf, welche Geschäftsmodelle besonders viele Kosten externalisieren, also an Umwelt und Gesellschaft auslagern.
- Ebenso könnte digitales Geld zahlreiche Abläufe automatisieren und das Leben der Menschen erleichtern. Da fast alles in unserer Welt auf Geld basiert, könnte eine digitale Währung vieles anhand der Zahlungsströme verifizieren und bestätigen, was heute noch bürokratische Prozesse erfordert.
- Die Kombination der genannten Punkte ermöglicht eine neue Form der Wirtschaftssteuerung, die gleich unzähligen Krisen entgegenwirken kann.
- Gleichzeitig gibt es viele kleinere Chancen, wie den Zugang zu einem Konto für jeden, sinkender Energieverbrauch für Transaktionen, die Auflösung des Datenmonopols der Tech-Giganten oder die Reduktion der Systemrelevanz bzw. Abhängigkeit von Banken und Finanzdienstleistern.
Auf der Contra-Seite sind vor allem technische, Cyber- und Datenschutzrisiken leicht vorstellbar. Ebenso besteht die Gefahr, dass Menschen mit geringer IT-Affinität (noch stärker) ausgeschlossen werden. Auch könnte es zu Verwerfungen im Finanzsystem kommen, wenn der eEuro die Geschäftsmodelle von Banken und Finanzdienstleistern gefährdet.
Ein viel größeres, dystopisches Risiko liegt darin, dass man digitales Geld den Neoliberalen und Tech-Konzernen überlässt oder zu wenige Schutzmechanismen implementiert – und so zukünftigen faschistischen Herrschern ein ideales Kontroll- und Repressionsinstrument in die Hand gibt. Diese Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen sollen in Teil 1 und 2 beleuchtet werden.
Warum das jetzt zählt
Wir sind „ahead of the curve“, würde man im Business-Neudeutsch sagen. Noch bevor digitales Geld final designt wird und sich etabliert, haben wir die Chance, seine Entwicklung aktiv mitzugestalten. Eine erste Idee soll unser Whitepaper: mit einem demokratischen eEuro gegen die Polykrise liefern. Details und anschauliche Beispiele finden sich im Buch „Rethink Money“
Digitales Zentralbankgeld ist kein technisches Detail. Es ist eine gesellschaftliche Weichenstellung – vergleichbar mit der Erfindung des Internets. Wenn wir es richtig gestalten, kann der digitale Euro ein Werkzeug werden, um unseren fehlerhaften Kapitalismus zu reparieren. Es besteht aber auch ein großes Risiko, dass die Digitalisierung von Geld die Perversitäten des Turbokapitalismus beschleunigt, denn Beschleunigen ist die eigentliche Kernaufgabe von Digitalisierungsvorhaben. Wenn wir den neoliberalen Kräften dieses zentrale Element unserer Gesellschaft überlassen, dann in ihrem Sinne gestalten und damit unzählige neue Probleme produzieren, sodass der Zivilgesellschaft nur reaktive Schadensbegrenzung übrig bleibt. Noch haben wir aber Zeit, die Neoliberalen mit ihrer eigenen Waffe zu schlagen – mit Geld.
Bislang haben vor allem große Tech-Giganten das disruptive Potenzial erkannt. Wenn die Zivilgesellschaft diesem Thema nicht annimmt, überlässt sie das Feld denjenigen, die ausschließlich Profitinteressen verfolgen – und dabei immer neue soziale, politische und ökologische Probleme verursachen.